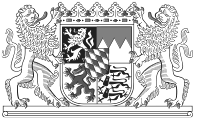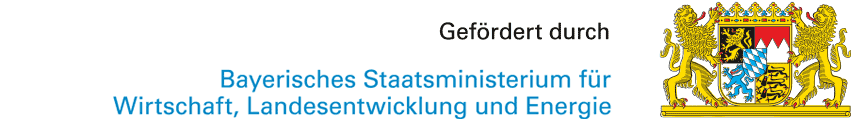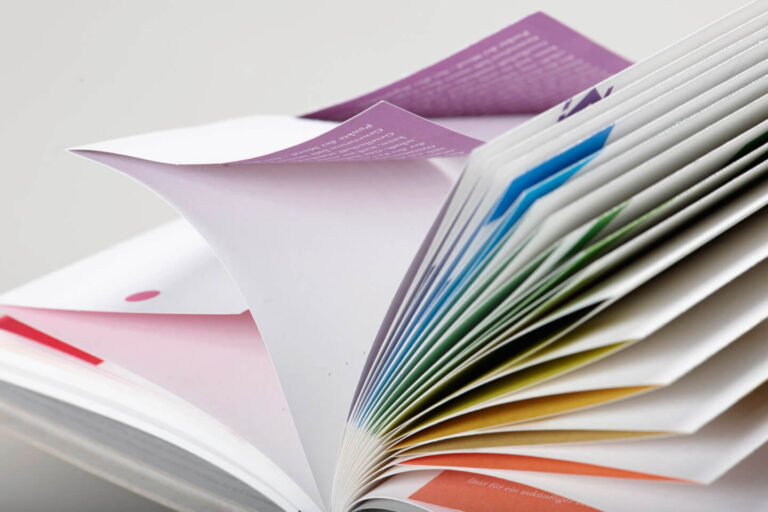Auf dem Holzweg
Die Renaissance des Holzbaus
von Joachim Goetz
Ein Traditions-Werkstoff wird wiederentdeckt und zeitgemäß interpretiert. Architekt:innen, Handwerker:innen und Industrie verleihen dem Holz ein neues Image
Seit die funktionalistische Moderne mit den Materialien Stahl, Glas und Beton ihre gefeierten architektonischen Meisterwerke kreierte, fristete der Holzbau in der Architektur ein Aschenputtel-Dasein. Das über Jahrtausende gebräuchliche Baumaterial galt nun als minderwertig, armselig, billig und vor allem rückständig. Die Assoziationen waren Blockhütte, Scheune oder Heuschober. Kühne baukünstlerische Ideen – enorme Bauhöhe, gestalterische Extravaganz, moderne Ästhetik – waren mit diesem Werkstoff nicht zu realisieren. Lehrstuhlinhaber:innen, die (traditionelle) Holzbautechniken lehrten, verspottete man nicht selten als „Holzwürmer“: Und vergaß darüber, dass das in Stein gebaute Venedig etwa auf 1000 Jahre alten Eichenpfählen ruht – und immer noch steht.
Heute ist wieder alles anders. Holzbau liegt im Trend. Im Einfamilienhausbau steigt die Verwendung von Holz bereits seit vielen Jahren stetig. Im „grünen“ Vorreiter-Land Baden-Württemberg sind etwa 25 Prozent aller neuen Objekte aus Holz, im Bundesdurchschnitt etwa 15. Seit einiger Zeit machen sogar Hochhäuser mit mehr als fünf Geschossen von sich reden.


Was sind die Gründe für den Boom?
Der Werkstoff gilt als gesund, belastet den Organismus nicht mit krank machenden chemischen Ausdünstungen. Holz schafft eine angenehme Atmosphäre und weist hervorragende Wärmedämmeigenschaften auf. Das Raumklima ist deshalb so gut, weil Holz ein schlechter Wärmeleiter ist – und so die hölzernen Innenwände, ‑böden und ‑decken kaum niedrigere Temperaturen als die Raumluft besitzen. Das verhindert kalte Strahlung, starke Luftturbulenzen und sorgt für einen heimeligen Effekt sowie hohe Behaglichkeit. Dieser Komfort ist vielen Häuslebauer:innen der im Vergleich mit konventionellen Bauten um etwa zehn Prozent höhere Baupreis offensichtlich wert.
Die Vorteile für die Umwelt: Holzbau ist Klimaschutz. Holz ersetzt Werkstoffe, die äußerst energieaufwendig erzeugt werden und speichert CO2 über die komplette Verwendungsdauer. Pro 150 Quadratmeter-Haus sind das 50 Tonnen. Außerdem wächst Holz nach. Angeblich so schnell, dass der – zugegeben unvorstellbar große – schwedische Wald in einer einzigen Minute den Holzbedarf eines Einfamilienhauses wachsen lässt. Ausgerechnet hat das die schwedische Firma Folkhem, die auch ein 22-geschossiges Holzhaus in Stockholm plante. Verwendet werden soll – kurze Transportwege sind nachhaltig – einheimische Fichte aus der Nachbarschaft. Zuvor hatte man gerne Zedernholz verbaut. Das musste aber über tausende Kilometer aus Kanada herangeschifft werden.
Die beiden höchsten Holzhäuser Europas stehen in Oslo und in Wien – wobei man das gar nicht mehr so genau weiß. Denn die Höhenrekorde purzeln ständig. In London ist ein 300 ‑Meter-Riese geplant, in Chicago einer mit 244 Metern. Und 2019 stand das global höchste hölzerne Exemplar noch in Heilbronn.
In München entstand seit 2017 mit dem Prinz-Eugen-Park auf einem ehemaligen Kasernengelände mit etwa 600 Wohnungen Europas größte Holzbausiedlung. Bis zu sieben Geschosse hoch sind die Bauten. Die in unterschiedlichen Konstruktionsmethoden erstellt wurden. Man unterscheidet dabei Holzmassivbau, Modul‑, Rahmen‑, Skelett- oder Hybridbau – wobei sich dies auch mischt.
Möglich ist das alles, weil die technologische Weiterentwicklung auch vor der hölzernen Natur nicht Halt macht. In Sachen Wärmedämmung, Lärm- und Brandschutz weist Holz dank moderner Materialtechnik (etwa Ummantelung mit Gipskarton) keine Nachteile (mehr) gegenüber anderen Baustoffen auf.
Im Bereich der Statik und Festigkeit übertrifft Holz sogar die Eigenschaften von Stahl, korrekte Verwendung vorausgesetzt. Dabei bringt es weniger Gewicht auf die Waage.
Auch der Bauprozess besitzt Vorteile. Da beim Holzbau viel exakter gedacht, geplant und schließlich gearbeitet werden muss – und wird, kann viel vorgefertigt werden. Das bedeutet andersherum: Das Gebäude kann meistens in Windeseile auf die zuvor fertiggestellten betonierten Fundamente aufgebaut werden. Vorfabrizierte Einfamilienhäuser, die in nur einem Tag einzugsfertig aufgestellt werden können, gibt es schon lange. Und selbst bei den mehrgeschossigen Vorzeigeobjekten dauert die Bauzeit – die man auch als „Montage“ bezeichnet – nur wenige Wochen.
Inzwischen werden sogar Fertighäuser von Industrierobotern montiert. Ständig weiter entwickelt sich auch die industrielle Aufbereitung von Holz. So hat etwa die norwegische Firma Kebony eine Veredelung von Kiefernholz mittels Bioalkohol entwickelt, der als Reststoff bei der Zuckerverarbeitung anfällt. Holz erhält so die Eigenschaften tropischer Harthölzer, es schwindet und quillt nur noch unbedeutend. Und kann so auch fürs Dach oder Pfosten-Riegel-Konstruktionen hergenommen werden.
Auch für Nachverdichtung – also Umbau, Aufstockungen, Ergänzungen – eignet sich Holz hervorragend. Das jedenfalls meint Hermann Kaufmann, der als einer der Protagonisten des modernen Holzbaus gilt, den Lehrstuhl „Holzbau und Entwerfen“ an der TU München innehat und den Holzbau-Atlas herausgibt. Denn Holz ist leicht, gut zu verarbeiten, effizient zu transportieren. Die Vorfertigung erlaubt schnelles und störungsarmes Bauen.


Auch größere innerstädtische Bauvorhaben werden inzwischen realisiert
Der Architekt Ludwig Wappner, der gerade im dicht bebauten München-Neuhausen ein großes Wohnobjekt namens Vincent mit begrünten Fassaden und Innenhof baut, plädiert für eine ressourcenschonende Hybridbauweise. Der Rohstoff Holz, von dem die Massivholzbauweise enorme Mengen verschlingt, steht nur begrenzt zur Verfügung. Es gilt kluge Wege zu finden, die kostbare natürliche Resssource verantwortungsvoll zu nutzen. Die Kombination mit anderen Materialien wie Mauerwerk, Lehm oder Ultraleichtbeton bietet sich an. Ganz aus Holz sind höhere Gebäude ohnehin nicht. Fundamente und Erschließungskerne sind bisher fast immer noch aus Beton, Erdgeschosse oft aus Mauerwerk – weil das die Bauordnungen so verlangen.
Vielleicht das Auffälligste am neuen Holz-Boom: Die Architektur hat das Blockhütten-Image abgestreift und muss sich in ästhetischer Hinsicht wirklich nicht verstecken.
Zitierempfehlung: Joachim Goetz (10.08.2022): Auf dem Holzweg. Die Renaissance des Holzbaus https://bayern-design.de/beitrag/auf-dem-holzweg/
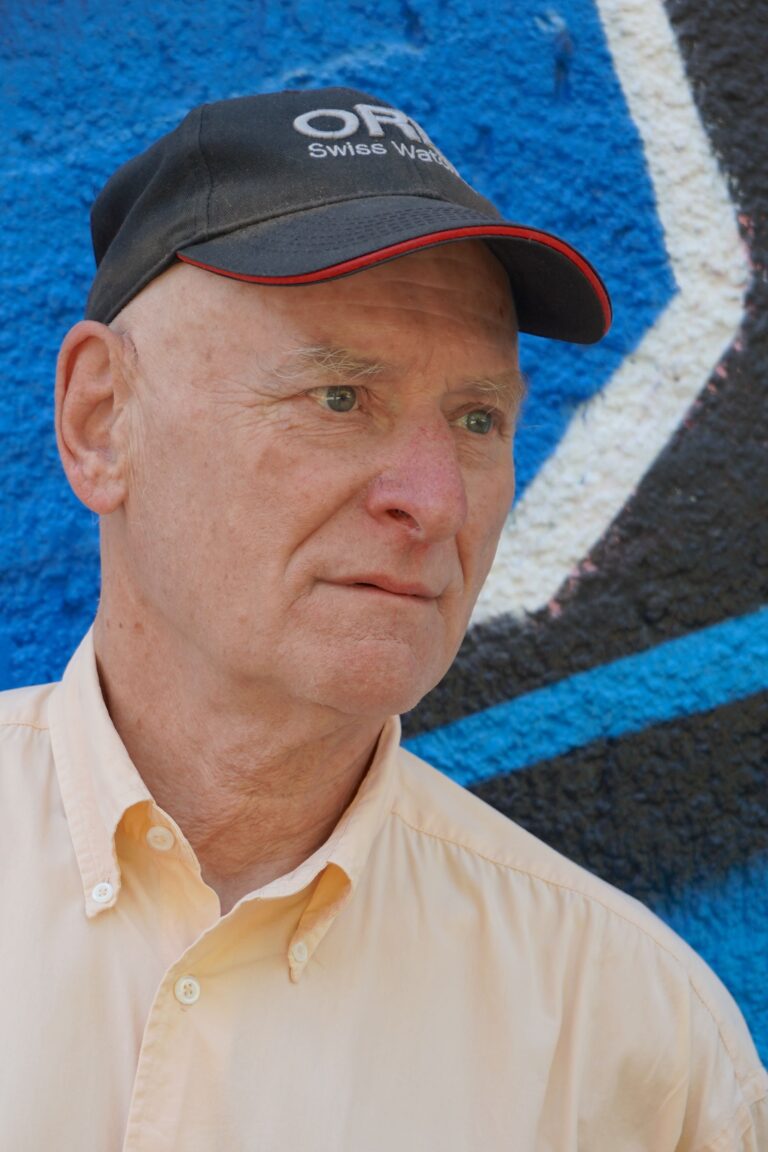
Der Autor Joachim Goetz studierte Architektur in München und Denver/Colorado mit Fächern wie Kunst- und Bauhistorie, Skulptur, Fotografie, Aquarell, Landschafts- und Produktgestaltung. Er arbeitete in Architekturbüros u. a. bei GMP, gewann Wettbewerbe mit Josef Götz und baute ein Haus mit Thomas Rössel und Heinz Franke. Seit 1990 ist er hauptberuflich als Autor tätig, war Redakteur bei Baumeister und WohnDesign. Publikationen erfolgten in nationalen und internationalen Tages‑, Publikums‑, Kunst- und Design-Zeitschriften wie SZ, Madame, AIT, Münchner Feuilleton, AZ oder Design Report. Interviews entstanden – etwa mit Ettore Sottsass, Günter Behnisch, Alessandro Mendini, Zaha Hadid, James Dyson, Jenny Holzer, Walter Niedermayr oder Daniel Libeskind. Zudem arbeitete er für Unternehmen wie Siedle, Phoenix Design, Hyve. Für Sedus wirkte er mitverantwortlich an der ersten digitalen Architekturzeitschrift a‑matter.com (1999–2004) sowie an der Kompetenzzeitschrift „Place2.5“ (2011–2014) mit. Für bayern design und die MCBW ist er immer wieder als Autor tätig. Seine Arbeit wurde von der Bundesarchitektenkammer mit einem Medienpreis für Architektur und Stadtplanung ausgezeichnet. Außerdem berät J. Goetz auch kleinere Unternehmen engagiert in speziellen Design‑, Marketing- und ausgefallenen Fragen.